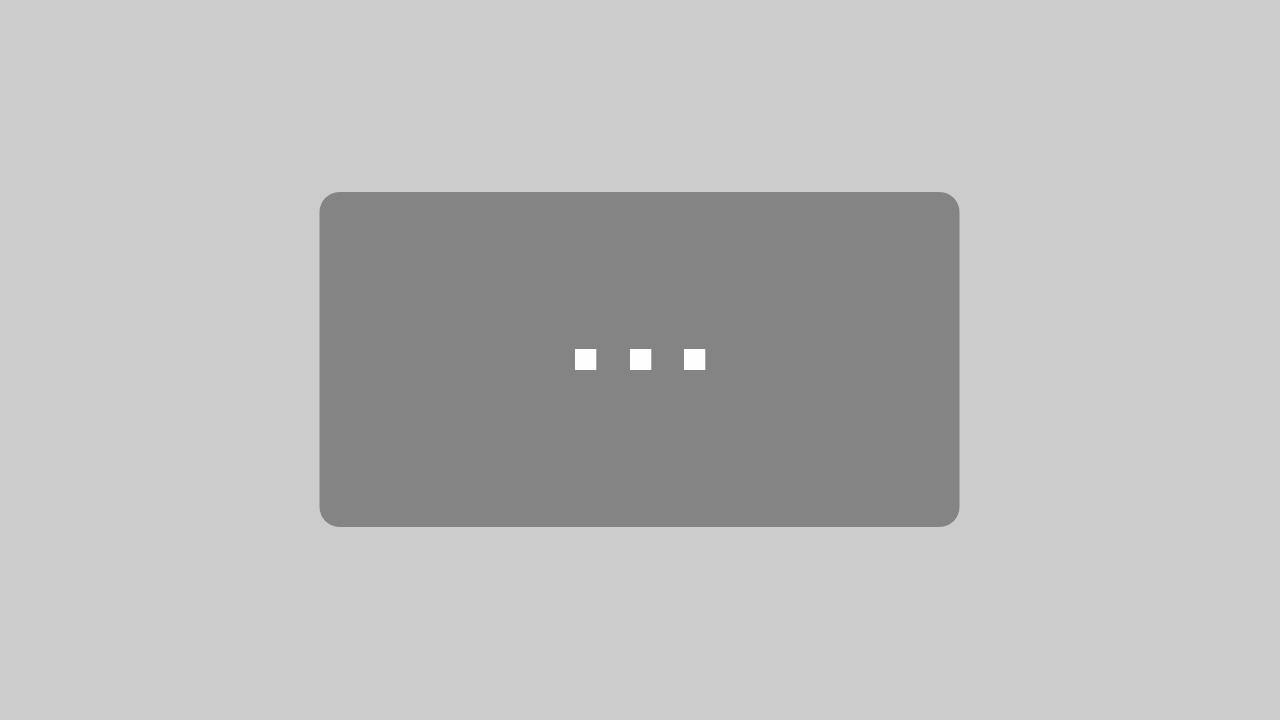Paul Greenman „Es geht um Bindung“
Vortrag vom 21.04.2022
- zusammengefasst von Alessandra Weber
Entstehung der Bindungstheorie
*01:10 – 15:10*Die Emotionsfokussierte Therapie beruht auf den Erkenntnissen der Bindungstheorie. Sein wichtigster Pionier, der englische Kinderpsychiater und Psychoanalytiker John Bowlby (1907-1990), wandte sich gegen das traditionelle psychoanalytische Modell und postulierte eine Theorie der Bindung als Primärbedürfnis. Während Freud die Mutter-Kind-Bindung als Triebbefriedigung erfasste, wagte der englische Psychiater eine radikalere These. In seinen klinischen Studien der 50er Jahren beschäftigte sich Bowlby mit den Auswirkungen von Verlust- und Trennungserfahrungen sowie mangelnder mütterlicher Fürsorge im Kindesalter und beobachtete den Zusammenhang zwischen psychischen Störungen, körperlichen Erkrankungen und Bindungstraumata. Basierend auf diesen Erkenntnissen setzte Bowlby die Grundlage der modernen Bindungsforschung: Das Bedürfnis nach Nähe und emotionaler Zuwendung sei ein biologisch1 angelegtes Primärbedürfnis, und zwar genauso essenziell wie das Bedürfnis nach Nahrung und körperlicher Versorgung; aus diesem Primärbedürfnis heraus besitzen Menschen die natürliche Fähigkeit, Bindung aufzubauen.
1 Bowlby verknüpfte klinisches Wissen mit evolutionsbiologischem Denken und so begründete er die Notwendigkeit von Bindung. Evolutionär verstanden, schützt Bindung vor Gefahren und erhöht die Überlebenschancen von Säugetieren.
Theoretische Grundlagen der Bindungstheorie
*15:11-32:29*Dieser Vortrag fasst 5 Grundsätze der Bindungstheorie zusammen. Den ersten Grundsatz formuliert Greenman kurz und prägnant: „Menschen brauchen Menschen“.2 Aneinander brauchen, aufeinander angewiesen sein ist notwendig für unsere psychische und körperliche Gesundheit.
Zweitens, (effektive) Abhängigkeit ermöglicht und fördert Autonomie. Eine effektive Abhängigkeit ist die Abhängigkeit, die wir in einer sicheren Bindung erleben, nämlich in einer Bindung, wo unsere Bindungsfigur emotional zugänglich, präsent und emotional engagiert ist. Emotionale Sicherheit ist also die Grundbedingung für Autonomie. Sie ist der Rahmen, wo Selbstbestimmung, Kreativität und Wachstum möglich sind.
Drittens, emotionale Zugänglichkeit und Responsivität von Bindungsfiguren fördern unsere psychische und physische Gesundheit. Eine Bindungsfigur ist zugänglich und responsiv, wenn sie emotional erreichbar ist und auf meine Bindungsbedürfnisse mit Empathie und emotionalem Engagement antwortet.
Viertens, die eher als negativ gesehenen Emotionen wie Unsicherheit und Angst aktivieren Bindungsbedürfnisse. Bindungsbedürfnisse sind Bedürfnisse nach Nähe, Schutz, Beruhigung und Trost. Diese können sich je nach Lebensphase und Lebenssituation zwar unterschiedlich zeigen, sind dennoch altersübergreifend und universell.
Fünftes, Emotionen beeinflussen unser Verhalten bzw. unser Verhalten wird dadurch bestimmt, wie wir mit Emotionen umgehen.
2 Siehe u.a.: Sue Johnson, Praxis der emotionsfokussierten Paartherapie, Junfermann, Paderborn 2021, S. 36.
Bindungstypen und Bindungsdimensionen
*32:30 - 40:50*Ein Bindungstyp oder Bindungsstil ist die „prototypische Art und Weise, sich in zwischenmenschlichen Beziehungen zu verhalten.“ Dieser entspricht also einem bestimmten Verhalten, wozu wir tendenziell neigen, wenn unsere Bindungsbedürfnisse aktiviert werden. Die Entwicklungspsychologin Mary Ainsworth (1913-1999) entwickelte in den 70er Jahren die „fremde Situation“, ein Setting zur Erfassung von Bindungstypen in der frühen Kindheit. In diesem Setting wurde das Verhalten von Kindern beobachtet, die in fremder Umgebung mit einer kurzen Trennung und der Wiedervereinigung mit der Mutter konfrontiert werden. Kindern, die während der Trennung traurig und gestresst waren, aber beim Wiedersehen Trost erleben konnten, Freude zeigten und die Umgebung weiter explorierten, wurde ein sicheres Bindungsmuster zugewiesen. Das Bindungsverhalten von Kindern, die hingegen ein unsicheres Bindungsmuster aufwiesen, teilte Ainsworth in zwei Bindungsstile ein: die ängstlich-ambivalente Bindung und die vermeidende Bindung.
Ängstlich-ambivalent gebundene Kinder zeigten sich in der Laborsituation selbst bei Anwesenheit der Bindungsperson unruhig und in ihrem Spiel- und Explorationsverhalten eingeschränkt. Während der Trennung waren sie ärgerlich und stark gestresst und selbst das Wiedersehen konnte sie nicht beruhigen, so dass sie die Bindungsfigur nicht loslassen wollten. Unsicher vermeidend gebundene Kinder zeigten bei der Trennung kein Anzeichen der Beunruhigung oder des Vermissens. Sie schienen emotional gleichgültig und spielten uneingeschränkt weiter. Spätere Studien konnten belegen, dass vermeidend gebundene Kinder physiologisch genauso gestresst sind, wie andere, die deutlichere Anzeichen von Unruhe zeigen.
Mary Main (*1943), Schülerin von Ainsworth, ergänzte die Bindungsmuster um eine weitere Kategorie: die desorganisierte Bindung. Kinder, die unsicher desorganisiert gebunden sind, weisen kein einheitliches Bindungsmuster auf. Sie zeigen sich teilweise ängstlich, teilweise vermeidend. Ein solcher Bindungsstil entwickelt sich häufig in Missbrauchssituationen, wo die Bindungsfigur das Kind misshandelt und ihm zugleich Trost spendet.
Mittlerweile spricht die Bindungsforschung von „Bindungsdimensionen“. Während das kategoriale Konzept von „Bindungsstil“ riskiert, eine Idee von festgeschriebenem Bindungsverhalten hervorzurufen, sollte der Begriff von Bindungsdimension einen vielschichtigeren Blick auf das Thema Bindung werfen können. Denn Bindungsverhalten kann, je nach Bindungsfigur und Partner, Lebensalter und Lebenssituation, eventuellen Bindungsverletzungen oder Traumaerfahrungen, mehr oder weniger variieren und einen unterschiedlichen Grad an sicheren oder unsicheren Tendenzen aufweisen.
Bindungsstrategien und innere Arbeitsmodelle
*40:51 - 46:30*Das Bindungsverhalten ist im Grunde die Art und Weise, in der wir in Beziehungen Emotionen regulieren. Da wir einander brauchen, um unsere Emotionen zu regulieren (Koregulation), ist eine sichere Bindung eine Bindung, wo die Koregulation von Emotionen grundsätzlich stattfinden kann und daher ein Grundgefühl von Sicherheit erschaffen wird, das Gefühl, dass jemand für mich da ist. Bei einer unsicheren Bindung ist das nicht der Fall. Ängstlich-ambivalent gebundene Menschen weisen hyperaktivierende Strategien auf, während eine unsicher-vermeidende Bindung vorwiegend mit deaktivierenden Strategien umhergeht. Eine hyperaktivierende Bindungsstrategie tritt auf, wenn die aktivierten Bindungsbedürfnisse (nach Nähe, Zuwendung und Trost) selbst bei Anwesenheit einer engagierten Bindungsfigur aktiviert bleiben. Deaktivierende Bindungsstrategien sind solche, die negative Emotionen überregulieren bzw. unterdrücken. Während deaktivierende Bindungsstrategien entstehen können, wenn die Bindungsfigur als konsequent abwesend verinnerlicht wird, können hyperaktivierende Strategien dann auftreten, wenn die Bindungsfigur nicht konsequent anwesend ist oder kein kohärentes Verhalten zeigt.
Aus der Art und Weise, in der wir unsere früheren Bindungsfiguren und die entsprechenden Bindungserfahrungen verinnerlichen, oder anders gesagt, das, was wir über Beziehungen gelernt haben, erzeugt ein „inneres Arbeitsmodell“ (Bowlby), also ein inneres „Schema“, das unser Bindungsverhalten steuert. Innere Arbeitsmodelle beinhalten Vorstellungen und Erwartungen hinsichtlich unserer Beziehungen in Bezug auf das Selbst – bin ich liebenswert? Wird auf meine Bindungsbedürfnisse positiv reagiert? – und auf unsere Bindungsfigur – wird jemand da sein, wenn ich das brauche? Kann ich auf andere zählen, kann ich anderen vertrauen?

Weitere Grundlagen der Bindungstheorie
*46:31 – 54:44*Die Erfahrung, dass Verbindung bedroht ist oder verloren geht, ist für Menschen traumatisch. Wir reagieren auf Isolation und Verlust mit Protest oder Anklammern und wenn alle Versuche erfolglos bleiben, können psychische Störungen und körperliche Krankheiten die Folgen sein.
Wir brauchen tatsächlich einander. Auch unsere Emotionen können wir wirksamer mit Hilfe anderer regulieren. Wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass Selbstregulation für unser Nervensystem schwieriger und aufwändiger als Koregulation ist. Selbst die Erinnerung oder das Denken an eine positive Bindungsfigur, kann uns dabei helfen, Stress abzubauen und negative Emotionen zu regulieren. Koregulation ist also die Grundlage für eine effektive Selbstregulation.

Die Paarbeziehung als Bindungsbeziehung
*54:45 - 01:07:30*Bis in die 80er wurde Bindung ausschließlich als Eltern-Kind-Beziehung erforscht. 1987 sind Hazan und Shaver der Frage nachgegangen, ob die Erkenntnisse aus der Bindungsforschung auch für Paarbeziehungen gelten können und haben die erste Studie über Paarbeziehungen als Bindungsbeziehungen durchgeführt. In ihren Studien haben sie herausgefunden, dass Paare ihre Beziehung als Bindungsbeziehung betrachten und dass Erwachsene die gleichen Bildungsstile wie Kinder haben.
Spätere Studien (Feeney & Nöller, 1991) konnten außerdem zeigen, wie auch das Bindungsverhalten im Erwachsenenalter von „inneren Arbeitsmodellen“ in Bezug auf Bindungsthemen, Bindungsstrategien und Bindungsbedürfnisse geprägt und beeinflusst wird und dass auch Paarbeziehungen als sichere oder unsichere Bindungen betrachten werden können.
In aktuelleren Studien (Feeney, 2016) konnten sicher gebundene Paare mehr Engagement, Zufriedenheit, Vertrauen sowie emotionale Interdependenz aufweisen als Paare, die unsicher gebunden waren. Und genau das ist das Ziel der Emotionsfokussierten Paartherapie: eine sichere Bindung zwischen den Partnern (wieder)herzustellen.
Bindung und Sexualität
*01:07:31 - 1:22:10*Aus evolutionärer Sicht ergibt die Bindung zwischen sexuellen Partnern Sinn: die Partner bleiben zusammen, kümmern sich um den Nachwuchs und sichern somit das Überleben der menschlichen Art. Es gibt also zwei Systeme, die miteinander interagieren und sich gegeneinander beeinflussen: das Bindungssystem, welches dafür sorgt, dass wir Nähe zu der Bindungsfigur erhalten, und das Sexualsystem, welches dafür sorgt, dass es zur Empfängnis kommt.
Paare, die sicher gebunden sind, erleben auch im sexuellen Bereich mehr Vertrauen, mehr Engagement und mehr Zufriedenheit. Sie erleben positive Emotionen in der Sexualität und verfügen über positive sexuelle Arbeitsmodelle: sie denken, dass sie sexuell interessant und ausreichend fähig sind, die sexuellen Bedürfnisse des Partners zu befriedigen, ohne die eigenen Bedürfnisse zu vernachlässigen. Das bestätigen die wissenschaftlichen Studien: je sicherer wir emotional gebunden sind, desto mehr können wir in der Sexualität kreativ und spielerisch sein.
Unsichere Bindungen weisen eine geringere sexuelle Zufriedenheit auf. In einer ängstlich-ambivalenten Bindung haben Paare die Tendenz, Verlustangst und Bedürfnisse nach Zuneigung und Trost zu sexualisieren, sowie Schwierigkeiten dabei, die eigenen sexuellen Bedürfnisse zu befriedigen. In einer vermeidenden Bindung zeigt sich auch im sexuellen Bereich wenig Engagement und wenig Vertrauen. Meistens neigen vermeidend gebundene Menschen dazu, durch ihr sexuelles Verhalten Nähe zu vermeiden bzw. unter Kontrolle zu halten.
Bindung und psychische Gesundheit
*1:22:11– 1:37:38*Ausgehend von Bowlby, behauptet die Begründerin der Emotionsfokussierten Paartherapie Sue Johnson, dass psychologische Probleme Bindungsprobleme seien und dass die Psychotherapie sich aus diesem Grund auf die Bindungswissenschaft ausrichten solle. Wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass Qualitätsbeziehungen vor psychischen Problemen schützen und Lebensqualität erhöhen, während unsichere Bindungen Ess- und Angststörungen, Persönlichkeitsstörungen, Posttraumatische Belastungsstörungen, sowie Depression und Suizidalität verursachen und verstärken können. Auch körperliche Krankheiten wie Herzkrankheiten, Schlaganfall und Diabetes treten bei Einsamkeit und Bindungsproblemen vermehrt auf.
Eine Studie von 2013 hat gezeigt, dass der körperliche Kontakt des Partners, mit dem die Probanden eine glückliche Ehe führten, das Gehirn bei Stress, Gefahr oder Angst nachweislich beruhigen kann. Eine sichere Bindung macht uns also tatsächlich gesünder. Ein Gewinn der Emotionsfokussierten Paartherapie ist, dass die psychische und, wie vermutet wird, auch die physische Gesundheit durch sichere emotionale Bindungen gefördert wird.
Paul Greenman